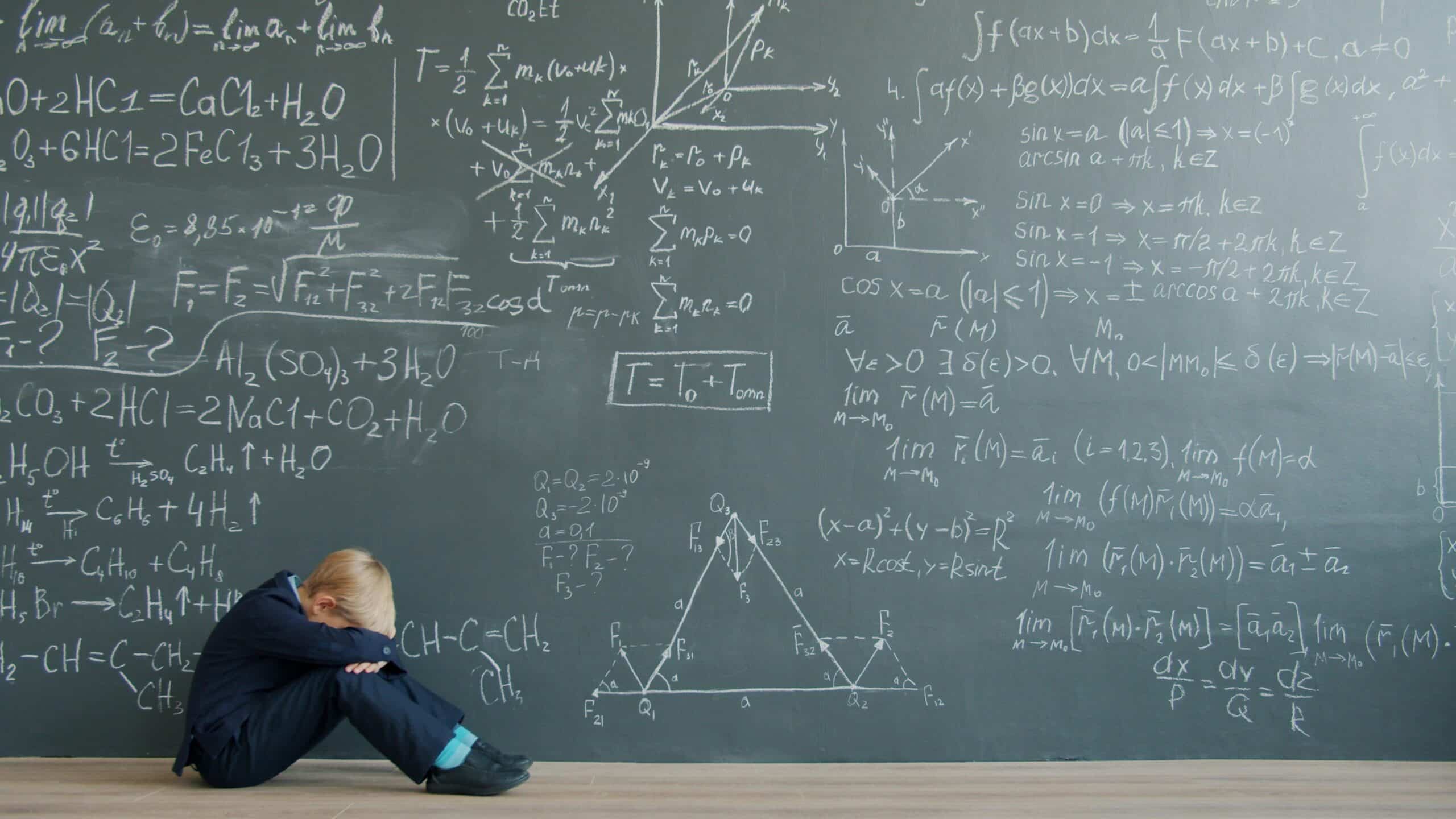Lernen ist zum Engpass der Transformation geworden
Viele Unternehmen spüren es täglich: Strategien verändern sich schneller als die Kompetenzen, die sie tragen. Märkte werden volatiler, Technologiezyklen kürzer, und die Veränderungsgeschwindigkeit überfordert klassische Lernsysteme.
Während KI, Cloud und Automatisierung längst die Wertschöpfung verändern, funktionieren betriebliche Lernarchitekturen oft noch wie vor zwanzig Jahren – mit Seminarangeboten, Schulungskatalogen und Trainingskalendern.
Das Ergebnis:
Mitarbeitende sind überfordert von Anforderungen, unterfordert im Lernen und abgekoppelt vom echter Kompetenzentwicklung.
Unternehmen investieren Millionen in Weiterbildung – und sehen kaum Wirkung auf Kundenerlebnisse, Produktivität oder Innovationsgeschwindigkeit.
Die neue Realität: Arbeit ist der Lernort
Veränderungsstabile Organisationen – also solche, die Wandel nicht nur aushalten, sondern daraus Energie gewinnen – begreifen Lernen als integralen Bestandteil der Arbeit.
Es wird nicht „separat gelernt“, sondern Arbeit selbst ist so gestaltet, dass sie Entwicklungsprozesse auslöst.
Ein Beispiel aus einem Projekt bei einem Maschinenbau-Unternehmen:
Ein Maschinenbauer wollte die Servicequalität internationaler Niederlassungen verbessern. Statt ein Schulungsprogramm zu entwerfen, wurde der Serviceprozess selbst die Quelle für Lerninhalte und -ziele.
- Jedes Service-Ticket wurde automatisch einem „Lernmoment“ zugeordnet.
- Nach Abschluss erhielt der Techniker Feedback zu seiner Leistung – gestützt auf Daten aus Kundenzufriedenheit, Reparaturdauer und Folgeaufträgen.
- Eine Konsequenz des Feedbacks war die Empfehlung von Lerneinheiten entsprechend möglicher Kompetenzlücken.
- Führungskräfte erhielten ein Dashboard, das zeigte, wo Kompetenzzuwachs tatsächlich stattfand, also die Lerneinheiten genutzt wurden und Verhaltensänderungen bewirkten – und wo nicht.
So wurde Lernen in den Arbeitsablauf integriert. Kaum zusätzlicher Aufwand, kein Ausfall von Mitarbeitenden wegen mehrtätiger Seminarteilnahme, aber messbare Verbesserung der Erstlösungsrate um 9 % in sechs Monaten.
Warum klassische Lernarchitekturen scheitern
Klassische Lernsysteme sind aus der Zeit gefallen, weil sie auf Stabilität gebaut wurden – nicht auf Veränderung.
Sie beruhen auf vier Irrtümern:
- Lernen geschieht im Seminar, nicht im Alltag.
- Menschen müssen belehrt werden, nicht ermächtigt.
- Wissen ist der Engpass, nicht das Verhalten.
- Führungskräfte delegieren Art und Weise der Lernens an Trainer und Learning Management Systeme (LMS), statt die Verantwortung für Veränderungen zu übernehmen.
Diese Logik führt dazu, dass Organisationen Inhalte und Formate managen, aber kein Verhalten verändern.
Der Output: abgeschlossene Kurse, aber keine adaptiven Kompetenzen.
Veränderungsstabile Organisationen drehen diese Logik um: Sie schaffen Umgebungen, in denen Verhalten, Reflexion und Feedback verschmelzen – und Lernen dadurch unsichtbar, aber allgegenwärtig wird.
Vom Trainingsprogramm zum Lernsystem
Ein funktionierendes Lernsystem hat drei Ebenen:
- Struktur – Arbeit ist so designt, dass sie Lernimpulse enthält.
- Technologie – Feedback- und Coachingmechanismen greifen in Echtzeit.
- Kultur – Lernen ist kein Defizit, sondern Ausdruck professioneller Exzellenz.
In einem Finanzdienstleistungsprojekt etwa wurde das Onboarding neuer Mitarbeitender völlig neu aufgesetzt. Statt 60 Tage „Einarbeitung“ wurde ein digitales Kompetenzmodell eingeführt, das jede Aufgabe mit einer Fähigkeit verknüpfte.
Eine KI-gestützte Feedbackfunktion analysierte reale Kundeninteraktionen und gab Hinweise, welche Verhaltensweisen die Zufriedenheit verbesserten.
So entstand ein lebendes System, das Produktivität und Lernfortschritt gemeinsam steuerte – und nach vier Monaten messbar höhere Kundenzufriedenheit (NPS + 12) erzielte.
Neurologisch wirksam, menschlich sinnvoll
Menschen lernen nicht durch Konsum, sondern durch Handlung, Emotion und Reflexion.
Das bedeutet: Jede Lernarchitektur, die Veränderungsstabilität fördern soll, muss neurologisch sinnvoll gestaltet sein.
Wir sehen in Projekten regelmäßig vier Erfolgsfaktoren:
- Kleine Lerneinheiten im Arbeitskontext: statt zweitägiger Seminare kurze, wiederholte Micro-Learnings im Alltag.
- Emotionale Aktivierung: Lernimpulse sind verknüpft mit echter Bedeutung – z. B. mit Kundenerlebnissen oder persönlichen Erfolgen.
- Reflexionsräume: Führungskräfte schaffen Rituale, um Lernen sichtbar zu machen, etwa durch „Learning Reviews“ am Monatsende.
- Feedback-Loops: Systeme spiegeln Fortschritt in Echtzeit – sichtbar, nachvollziehbar, motivierend.
Lernen wird so Teil des Arbeitsalltags– und Teil des Selbstbilds.
KI als Verstärker des Lernens
Der Einsatz von Künstliche Intelligenz ist kein Selbstläufer.
KI entfaltet erst dann ihren Nutzen, wenn sie das Lernen selbst verbessert.
Drei Prinzipien sind entscheidend:
- Personalisierung: Systeme erkennen Kompetenzlücken automatisch und schlagen individuelle Lernimpulse bzw. Lernreisen vor.
- Augmentation: KI unterstützt Reflexion, Feedback und Entscheidungsfindung, statt Menschen zu ersetzen.
- Wirkungsmessung: Daten werden genutzt, um Lernfortschritt sichtbar zu machen – nicht um Kontrolle zu erhöhen.
In einem internationalen Customer Experience-Programm, das wir begleitet haben, kam ein KI-basiertes Coaching-System zum Einsatz, das Gesprächsdaten aus Servicecentern auswertete.
Die KI gab Hinweise zu Empathie, Klarheit und Lösungsorientierung.
In Kombination mit wöchentlichen „Team Learning Sessions“ erhöhte sich die Erstlösungsrate um 11 %, der Kundenzufriedenheitswert stieg signifikant.
Der Schlüssel: Technologie als Coach, nicht als Richter.
Der Return on Learning – wie Lernen auf den Unternehmenserfolg einzahlt
Veränderungsstabile Organisationen messen Lernen nicht in „absolvierten Kursen“, sondern in wertschöpfender Wirkung.
Wie das konkret aussieht, zeigen drei Beispiele aus Projekten:
- Kompetenzentwicklung im Kontext:
In einem globalen Logistikkonzern wurde Lernfortschritt anhand echter Projektleistung gemessen. Ein Datenmodell verknüpfte die Häufigkeit erfolgreicher Kundenlösungen mit dokumentierten Lernschritten. Ergebnis: 8 % Absenkung der Prozesslaufzeiten, +14 % Mitarbeiterbindung. - Organisatorische Agilität:
Ein Finanzdienstleister erfasste, wie schnell Teams neue Fähigkeiten produktiv einsetzen konnten. Ergebnis: 30 % kürzere Zeit von der Einführung neuer Tools bis zur stabilen Nutzung – ein klarer Indikator für Lerngeschwindigkeit. - Business Outcomes:
In einem CX-Transformationsprojekt korrelierte Lernaktivität (z. B. Reflexionsrunden, Peer-Feedback, Skill-Tracking) mit Kundenzufriedenheit und Umsatz pro Kunde. Das Lernen selbst wurde zur Stellgröße für den Net Promoter Score.
Diese Art von Metrik verschiebt den Blick: Lernen ist kein Kostenfaktor, sondern ein Produktionsfaktor für Veränderungsfähigkeit.
Führung neu denken – vom Sponsor zum Lernarchitekten
Führung ist der entscheidende Hebel.
Veränderungsstabile Organisationen verstehen Führungskräfte als Architektinnen und Architekten der Lernbedingungen.
Sie sorgen dafür, dass Teams im Tun wachsen können.
Ein Beispiel aus einem Projekt bei IT-Outsourcing-Unternehmen:
Statt Rückmeldungen nur in Jahresgesprächen zu geben, wurde ein „Learning Snapshot“ eingeführt – eine kurze, wöchentliche Reflexion unter Moderation der Führungskraft, die drei Fragen stellt:
- Was habe ich diese Woche gelernt?
- Was werde ich nächste Woche ausprobieren?
- Wen habe ich dabei unterstützt, etwas Neues zu lernen?
Die Ergebnisse wurden anonymisiert gesammelt, um Lernpfade und -barrieren im System sichtbar zu machen.
Nach drei Monaten zeigte sich: Teams mit regelmäßigen Snapshot-Meetings erzielten signifikant höhere Problemlösungsqualität – und eine um 17 % höhere Nutzerzufriedenheit.
Lernsysteme datenbasiert steuern
Lernsysteme müssen sichtbar machen, wo Lernen wirklich passiert.
In der Praxis bedeutet das:
- Dashboards, die Lernfortschritt direkt an Geschäftskennzahlen koppeln.
- Datenmodelle, die Lernmuster erkennen – etwa, wo Wiederholungsfehler auftreten oder welche Teams besonders schnell adaptieren.
- KI-gestützte Analysen, die individuelle Lernreisen anpassen, sobald ein Plateau erreicht ist.
In einem unserer Projekte wurde ein solches System im Vertrieb eingesetzt.
Es zeigte, welche Verhaltensänderungen zu höherer Abschlussquote führten – und welche Trainings kaum Wirkung hatten.
Nach drei Monaten konnten 40 % des Trainingsbudget zielgerichteter eingesetzt werden – bei gleichzeitig besseren Ergebnissen.
Kundenzentrierung beginnt beim Lernen
Kundenzentrierung ist kein Kommunikationsprinzip – sie ist ein Lernprinzip.
Nur wer systematisch aus Kundenfeedback, Interaktions-Metriken und Erfolgsgeschichten lernt, kann dauerhaft CX-Exzellenz erreichen.
Deshalb integrieren veränderungsstabile Organisationen Kundenlernen in ihre Lernsysteme:
Jede Interaktion wird zur Datengrundlage, jeder Kunde zum Entwicklungsimpuls.
CX ist kein Zielzustand, sondern ein fortlaufender Lernprozess zwischen Organisation und Markt.
Wenn das für Sie relevant ist, dann …
… sollten wir miteinander sprechen.
Wenn Sie merken, dass Ihre bestehenden Lernstrukturen nicht mehr tragen, dass Weiterentwicklung zu viel Aufwand und zu wenig Wirkung erzeugt, und dass Sie Lernen als strategisches Führungsinstrument neu aufsetzen wollen – dann gestalten wir das gemeinsam.
So starten wir typischerweise ein Projekt:
1. Erstes Klärungsgespräch: Wir verstehen Ihr Geschäftsmodell, Ihre Herausforderungen und Ihre Lernarchitektur.
2. Diagnose-Workshop: Wir analysieren, wo Lernen blockiert – strukturell, kulturell, technologisch.
3. Projektskizze: Wir entwerfen gemeinsam ein Zielbild, messbar und verankert im Geschäftsergebnis.
4. Pilotphase: Wir testen erste Interventionen im realen Arbeitsumfeld.
5. Skalierung: Wir begleiten den Transfer in Prozesse, Führungssysteme und Technologie.
...ist Vorstand bei der O’Donovan Consulting AG. Seit mehr als 18 Jahren steht die Lösung von Herausforderungen aus Vertrieb und Service in Verbindung mit innovativen technologischen Lösungen im Fokus seiner Tätigkeit. Aktuell unterstützt er seine Auftraggeber dabei, Strategien für eine kundenorientierte Unternehmensführung zu entwickeln und im Unternehmen umsetzen. „Unternehmen können am Markt gewinnen, wenn Sie es schaffen, Services in Abhängigkeit der jeweiligen Situation zu individualisieren, dass Kunden bleiben – am besten aus Bequemlichkeit, gerne auch aus Begeisterung.''
Sie erreichen ihn unter matias.musmacher@donovan.de.